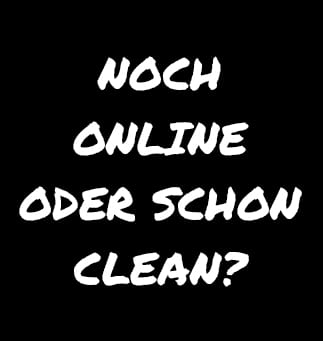Getrennt und verbunden
in der digitalen Lebenswelt
Zu Anfang war es nur ein Mittel um den Freunden eine kurze Nachricht zu schreiben. Inzwischen ist das Smartphone weit mehr als das und wegen seiner vielen Funktionen aus dem Alltag kaum wegzudenken. Es macht das Leben einfacher, kann aber auch den Stresspegel in die Höhe treiben. Es verbindet Menschen über Kontinente und trennt Gesprächspartner, die sich direkt gegenüber sitzen. Der Griff zum kleinen Alleskönner ist oft Gewohnheit, manchmal fast Instinkt. Und wenn plötzlich das Mobilfunknetz fehlt, kommt man nicht umhin sich zu fragen: Hat mich das Smartphone in der Hand oder ist es doch andersherum?
Das Leben ohne Smartphone – eine Utopie?
Von Henrike Mielke
Zehn Tage ohne Mobiltelefon, diesen Selbstversuch hat Marina Röhrich 2010 für das Stimmt-Magazin gemacht. „Heute kann ich mir das nicht mehr vorstellen“, sagt die 27-Jährige. Brauchte sie das Handy früher vor allem um per SMS mit Freunden in Kontakt zu bleiben oder im Notfall von unterwegs anrufen zu können, ist es jetzt in vielen Lebensbereichen für sie unverzichtbar geworden. An einer langen grünen Kordel hängt das Iphone um den Hals der 27-Jährigen, immer griffbereit.
„Das Smartphone hat unser Leben und unsere Alltagswelt sehr stark verändert, aber nicht grundlegend“, erklärt Katharina Knop-Hülß. wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung. „Wir haben immer noch ein tiefes, grundlegendes Bedürfnis nach Verbundenheit.“ Allerdings gebe es jetzt dafür ganz neue soziale Kontexte wie Facebook, WhatsApp und Instagram.

Grundlegend ist das Bedürfnis nach Verbundenheit
Da ist es nicht verwunderlich, dass Marina schon vor neun Jahren bei ihrem Selbstversuch zu dem Schluss kam: „Das Schlimmste ist wahrscheinlich, dass ich Freunden, die ich nicht täglich sehe, nicht einfach mal eine SMS schreiben kann.“
Gerade für Kontakte im Ausland sind Plattformen wie Facebook wichtig. So kann sie mit ihrer Gastfamilie aus der Zeit als Au-Pair in den USA in Kontakt bleiben, teilt über das soziale Netzwerk wichtige Lebensereignisse wie Geburtstage mit ihnen.
Doch einiges hat sich auch verändert. War das Mobiltelefon früher in erster Linie ein Mittel zur Kommunikation, ist es jetzt vieles mehr. Schon lange hat Marina Röhrich keine Digitalkamera und keinen MP3-Player mehr. Auch der Wecker ist von ihrem Nachttisch verschwunden. Dafür nutzt sie jetzt das Smartphone. Auch wichtige Dokumente wie Zug- oder Flugtickets sind dort gespeichert, außerdem der Zugang zum Onlinebanking. Ihren Nebenjob, bei dem sie AuPair-Bewerber über Skype und Facetime interviewt, könnte sie ohne Smartphone gar nicht machen.
Immer erreichbar – das ist inzwischen eine gesellschaftliche Norm
„Alle erwarten, dass man ein Smartphone hat und verfügbar ist“, sagt die Heilbronnerin. Erreichbarkeitsnorm nennt Kommunikationswissenschaftlerin Knop-Hülß diese Erwartungshaltung. Sei man in einem abgelegenen Urlaubsort ausnahmsweise nicht erreichbar, müsse man sich entschuldigen oder vorher darauf hinweisen. Im Sommerurlaub in Südamerika hat Marina Röhrich die Erfahrung gemacht, dass es aber auch sehr angenehm sein kann, für Nachrichten nicht erreichbar zu sein. Im Hotel hatte sie W-Lan, aber unterwegs blieb das Handy stumm.
„Smartphone-Gebrauch ist sehr stark habitualisiert. Der Alltag ist von Online-Medien durchzogen“, erklärt Knop-Hülß. Auch wenn man gerade nicht ständig aktiv betetiligt sei, so halte man sich doch in Bereitschaft. Da steigt bei vielen der Stresspegel. Permanent online, permanent in Verbindung – das verbraucht auch kognitive Resourcen, die dann für andere Aufgaben nicht mehr zur Verfügung stehen – wenn man zum Beispiel überlegt, wem man noch kurz eine Nachricht schreiben könnte, mit wem man ein Ereignis noch teilen könnte. „Es gibt Menschen, die ihre Umwelt darauf scannen, ob ein Moment Instragram-würdig ist“, sagt Knop-Hülß. „Das passiert parallel zu dem was wir physisch erleben.“ Stress entsteht dann auch durch die daraus resultierenden Konflikte: Mache ich jetzt ein Foto oder nehme ich am Gespräch teil?
Konflikt zwischen den Lebenswelten: offline oder online?
Für Marina Röhrich ist klar, dass sie ihr Smartphone nicht beachtet, wenn sie Zeit mit Freunden oder Familie verbringt. Trotzdem ist sie sich sicher, dass sie wesentlich mehr Zeit am Bildschirm verbringt als noch vor neun Jahren. Regelmäßig bekommt sie auf ihrem Smartphone eine Meldung über die Bildschirmzeit: „Das ist sehr erschreckend, bei einem faulen Tag daheim kann die relativ lang sein.“ Mit dieser Erkenntnis ist sie nicht alleine. Einer Onlinestudie von ARD und ZDF zufolge sind die Deutschen im Durchschnitt etwa dreieinviertel Stunden online, bei den 14- bis 29-Jährigen sind es sogar zweieinhalb Stunden mehr. „Wäre exzessive Nutzung das alleinige Merkmal, wären wohl viele Menschen Smartphone-süchtig“, sagt Knop-Hülß. Wie bei anderen Süchten, sind es aber eher Probleme in der Lebensführung und körperliche Entzugssymptome wie innere Unruhe, die auf ein Problem hinweisen. Es empfiehlt sich bewusst mit dem digitalen Konsum umzugehen. „Wenn man sich dabei erwischt, dass man sich freut kein Netz zu haben, sollte man sich überlegen ob man das wirklich braucht“, so Knop-Hülß.
Gemeinsam neue Apps entdecken
Von Henrike Mielke
Fahrradfahren, Schwimmen, Zähne putzen – viele Fertigkeiten, die ein Kind braucht um im Leben zurecht zu kommen, lernt es von seinen Eltern. Durch die Digitalisierung und die rasante Weiterentwicklung von Apps, entstehen immer öfter Situationen in denen Kinder ihren Müttern und Vätern voraus sind. Die machen sich oft Sorgen und fragen dann Fachleute um Rat. Silke Gröhner von der Fachstelle für Internet- und Medienkonsum der Diakonie Heilbronn gibt praxisnahe Tipps und berichtet von Erfahrungen aus der Beratung. Fabian Karg vom Landesmedienzentrum BW und Dr. med. Tina Schlüter vom Klinikum am Weissenhof ergänzen mit Fachwissen.

Was sind die Sorgen der Eltern?
Der ist mit seinem Kopf immer woanders“ sagen die Eltern zu Silke Gröhner. „Das kann doch nicht gesund sein so viel Zeit mit dem Smartphone zu verbringen.“ Die Diplomsozialarbeiterin berät bei der Diakonie in der Fachstelle für Internet- und Medienkonsum vor allem besorgte Eltern von Kindern im Altersbereich von zehn bis 20 Jahren – vom Grundschulkind bis zum Jungen Erwachsenen.
Die Mütter oder Väter berichten ihr oft, dass sie Sorge haben ihr Kind würde nur noch am Smartphone hängen, wenn sie es ließen. Silke Gröhner erinnert dann daran, dass es immer auch Situationen gebe, in denen die jungen Menschen das Gerät von selbst aus der Hand legen. Diese Interessen könne man erkennen und bestärken.
Gerade in sehr jungen Jahren sei auch das Erleben der Welt mit allen Sinnen sehr wichtig für die Entwicklung. Deshalb sei es auch nicht sinnvoll dem Kind schon vor dem Übergang in die weiterführende Schule ein Smartphone zu schenken. Um im Notfall die Eltern anzurufen oder schnell eine Nachricht zu schreiben, ist ein einfaches Mobiltelefon für Grundschulkinder ausreichend.
Was hilft gegen Angst vor der digitalen Lebenswelt der Kinder?
Oft ist es das Ungewisse, das uns Angst macht. So auch in diesem Fall. Silke Gröhner weiß aus Erfahrung, dass offene Gespräche helfen. „Wenn Eltern wissen wo ihr Kind online unterwegs ist, mit was es sich beschäftigt – das kann stark entlasten“, erklärt die Sozialpädagogin. Einfach mal fragen, sich zeigen lassen, selbst mitmachen. Die Familien können auch vereinbaren, dass sie sich in größeren Abständen gemeinsam das Instagram-Profil anschauen. Nicht Kontrolle, sondern Unterstützung im Umgang mit den Geräten sei von den Eltern gefragt. „Das wichtigste ist, dass die Eltern nicht den Kontakt zu ihren Kindern verlieren“, sagt Silke Gröhner.
Wenn sich Eltern oder Großeltern mit dem Kind zusammensetzen und sich neue Funktionen bei WhatsApp zeigen lassen oder das neue Video vom Lieblings-Youtuber gemeinsam anschauen, dann kann das auch einfach Spaß machen. „Das ist natürlich auch eine Möglichkeit Beziehung herzustellen. Kinder empfinden das immer als positiv, wenn Eltern ihnen Aufmerksamkeit schenken“, erklärt Gröhner. In jedem Fall sollten Eltern darauf achten, was ihre Kinder online machen. Verabrede sich die Tochter mit einer neuen Schulfreundin zum Spielen, wolle man ja schließlich auch wissen wohin sie gehe und ob es dort für sie sicher sei.
Wann wird es problematisch?
Ob die Zeit am Smartphone wirklich ein Problem darstellt, lässt sich nur individuell klären. Vernachlässigt der Sohn die sozialen Kontakte, schreibt schlechtere Noten und geht keinen anderen Interessen mehr nach, ist das kein gutes Zeichen. „Kinder haben oft Probleme mit der Selbstregulierung. Sie können nicht so gut einschätzen, wann es Zeit ist, wieder aufzuhören“, erklärt die Sozialarbeiterin. Hilfreich seien klare Zeiten für die Handynutzung. Logisch, dass sich daran auch die Eltern halten müssen, sie haben schließlich Vorbildfunktion. Hat der Vater abends das Smartphone auf dem Tisch liegen und checkt noch nebenbei Mails, lernen Kinder dieses Verhalten.
Eine tolle Sache sei das, wenn der Sprössling Mama oder Papa neue Funktionen bei WhatsApp erklärt oder auch mal ein lustiges Video gemeinsam angeschaut wird. „Das wichtigste ist, dass die Eltern nicht den Kontakt zu ihren Kindern verlieren“, sagt Silke Gröhner. Den jungen Menschen dabei zu helfen Medienkompetenz zu erwerben hält Gröhner inzwischen für genauso wichtig, wie ihnen das Fahrradfahren beizubringen.
Was macht beim Smartphone das Suchtpotential aus?
Ablenkung und Entspannung, das bietet das Smartphone. Das sei bei Kindern wie Erwachsenen gleich, weiß Dr. med. Tina Schlüter vom Klinikum am Weissenhof zu berichten. Auch um unangenehmen Themen und Gefühlen auszuweichen, greife man zum Smartphone. Hinzu kommt die Wichtigkeit des Smartphones als Kommunikationskanal für Jugendliche. „Nicht online und nicht erreichbar zu sein, löst eine große Angst des Nichtmehrdazugehörens aus“ erklärt Schlüter. Außerdem könne man über Spiele eine Selbstbestätigung durch Erfolgserlebnisse erleben, die im realen Leben schwerer erzielt werde.
Wie können Eltern ihren Kindern helfen verantwortungsvoll damit umzugehen?
Dass Eltern die digitalen Lebenswelt ihrer Kinder kennen lernen, findet auch Fabian Karg vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg wichtig. In Workshops und Vorträgen, unter anderem auch an der aim in Heilbronn, erklärt er Eltern und Lehrern die Mechanismen, die hinter den Plattformen stehen und dazu führen, dass man nur schwer aufhören kann. Auch er plädiert dafür sich mit der Tochter oder dem Sohn gemeinsam die Apps anzuschauen und eben auch zu erklären nach welchen Mechanismen sie konstruiert sind.
Die Anwendungen seien darauf ausgelegt, dass der Nutzer geradezu kleben bleibe, im Englischen wird der Fachausdruck „stickiness“ verwendet. „Man kann mit wenig viel erreichen, mit nur zwei Klicks bekommt man schon ein Erfolgserlebnis“, erklärt Karg. Deshalb sei es umso wichtiger, dass zum Beispiel auch Lehrer in der Schule oder Eltern daheim das Kind aktiv loben damit es auch offline Erfolgserlebnisse haben und Bestätigung erfahren kann. „Wir streben danach, Anerkennung zu erhalten“, erklärt er. Werde zu sehr auf die schwäbische Art gelobt – gar nicht – so biete die digitale Lebenswelt dem Kind viel mehr.
Kern der Medienkompetenz sei es, dem Kind nicht nur zu vermitteln wie man eine App bedient, also auf was es klicken muss, sondern auch wie es die Funktionen zu bewerten hat. Reflektieren zu können, was da genau passiert und wie die Apps eigentlich funktionieren, sei wesentlich wichtiger. „Bevor man Wert darauf legt, die Klick-Kompetenz zu schulen, sollte man Wert auf die Bewertungskompetenz legen“, stellt Karg klar.